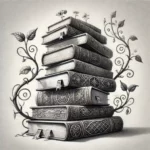Emden – Kurz und knackig
Das Wichtigste an einem Nachmittag
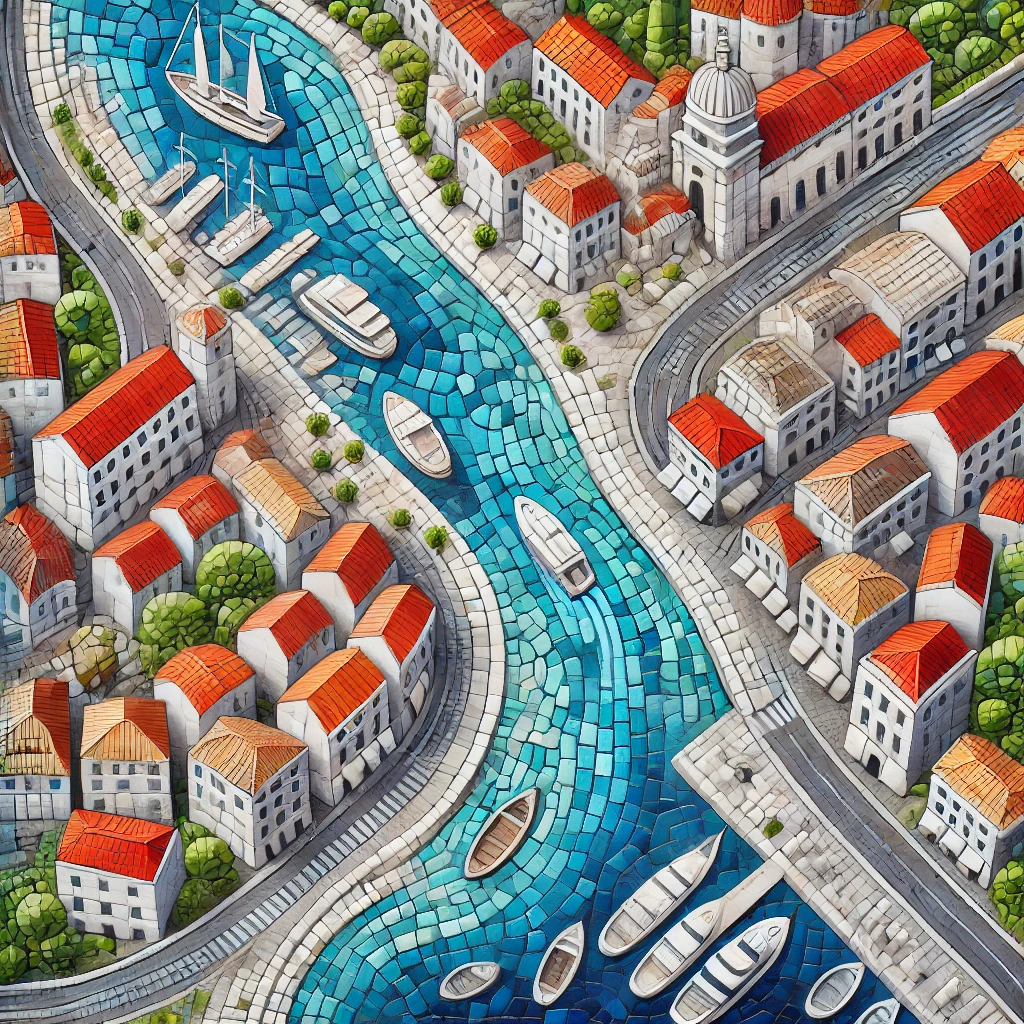
Emden liegt im Nordwesten Deutschlands, mitten in Ostfriesland, dort, wo das Land flach und der Himmel weit ist. Die Stadt zählt rund 50.000 Einwohner und ist geprägt vom Wasser: Kanäle durchziehen das Zentrum, der Hafen liegt unmittelbar neben der Altstadt, und das Meer ist nur wenige Kilometer entfernt.
Die Besiedlung des Emder Raums reicht bis in die Jungsteinzeit zurück. Im 8. oder 9. Jahrhundert entstand hier eine friesische Handelsniederlassung, aus der sich im Laufe der Jahrhunderte die Stadt entwickelte. Im 16. Jahrhundert wurde Emden zu einem Zentrum des Calvinismus und war Zufluchtsort für protestantische Glaubensflüchtlinge. In dieser Zeit wurde die Stadt wegen ihrer religiösen Bedeutung und Unabhängigkeit auch das „Genf des Nordens“ genannt – ein Hinweis auf ihre Rolle während des Achtzigjährigen Kriegs und der Reformation.
Am 6. September 1944 wurde Emdens Altstadt bei einem britischen Luftangriff innerhalb von 30 Minuten nahezu vollständig zerstört. Der Wiederaufbau stellte die Stadt vor große Herausforderungen, doch einige historische Gebäude wie die Pelzerhäuser konnten erhalten oder rekonstruiert werden.
Heute ist Emden eine ruhige, freundliche Stadt mit viel kulturellem Leben, klaren Konturen und kurzen Wegen. Der folgende Rundgang führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum – zu Fuß, in einem Bogen, der das Vergangene mit dem Gegenwärtigen verbindet. Startpunkt ist das Ostfriesische Landesmuseum im Herzen der Stadt.
Ostfriesisches Landesmuseum – Geschichte unter Glas
Im Zentrum der Stadt, direkt am Emder Rathaus gelegen, befindet sich das Ostfriesische Landesmuseum. Wer das moderne, lichtdurchflutete Foyer betritt, steht in einem Haus, das Geschichte auf mehreren Ebenen erzählt – wortwörtlich wie sinnbildlich.
Die Ausstellung beginnt mit archäologischen Funden aus der Frühzeit der Region und führt weiter durch die wechselvolle Geschichte Ostfrieslands – vom friesischen Häuptlingswesen über den Einfluss der Grafen und Fürsten bis zur Blütezeit des Seehandels im 16. und 17. Jahrhundert. Besonders eindrucksvoll ist die Sammlung alter Navigationsinstrumente, die die enge Verbindung zur Seefahrt sichtbar macht. Wechselnde Sonderausstellungen greifen zudem aktuelle Themen auf, oft mit regionalem Bezug.
Architektonisch interessant ist der fließende Übergang zwischen Museum und Rathaus. Das moderne Glasdach verbindet die alten Mauern des Rathauses mit dem Neubau und schafft so ein Raumgefühl, das Vergangenheit und Gegenwart vereint.
Weg zum Ratsdelft: Vom Museum aus geht es in wenigen Minuten zu Fuß Richtung Wasser. Der Weg führt vorbei an kleinen Läden und Cafés, durch schmale Gassen mit typisch norddeutscher Backsteinarchitektur. Bald öffnet sich der Blick auf den Ratsdelft – ein langgestrecktes Hafenbecken, das mitten in der Stadt liegt und Emden seinen unverwechselbaren maritimen Charakter verleiht.

Ratsdelft – Schiffe, Wasser, Geschichte

Der Ratsdelft ist das alte Herz der Emder Hafenstadt. Früher legten hier Handelsschiffe aus aller Welt an, heute ist das langgestreckte Hafenbecken ein ruhiger Ort mit historischer Atmosphäre. Der Blick über das Wasser reicht bis zum Emder Hafenkran, der als technisches Denkmal erhalten geblieben ist. Am Kai liegen drei Museumsschiffe, jedes mit eigener Geschichte, gemeinsam ein lebendiges Denkmal der Seefahrt.
Am auffälligsten ist die „Georg Breusing“, ein alter Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Gebaut 1963, diente er bis in die 80er Jahre auf Borkum. Besucher können das Schiff betreten und sich einen Eindruck vom beengten Leben an Bord verschaffen.
Gleich daneben liegt der Heringslogger AE7 „Stadt Emden“, ein Zeuge der einst bedeutenden Heringsfischerei. Der Logger erinnert an eine Zeit, in der Fischfang ein harter, aber lebensnotwendiger Broterwerb war – nicht nur für Emden, sondern für viele Hafenorte an der Nordsee.
Etwas weiter liegt die „Amrumbank“, ein ehemaliges Feuerschiff, das über Jahrzehnte vor der Nordseeküste als schwimmender Leuchtturm diente. Heute ist das rote Schiff ein beliebtes Fotomotiv – und ein Ort zum Entdecken für alle, die sich für Nautik und Navigation interessieren.
Diese Schiffe sind nicht nur Einzelstücke, sondern Teil einer größeren maritimen Geschichte, die den Hafen über Jahrhunderte geprägt hat.
Am Ufer laden Bänke zum Verweilen ein. Außerdem gibt es einige Cafés am nahe gelegenen Stadtgarten mit Blick auf den Hafen. Der Blick auf die ruhige Wasserfläche, flankiert von alten Häusern und modernen Bauten, vermittelt eine besondere Stimmung.
Weg zu Pelzerhäusern & Bibliothek: Vom Ratsdelft führt ein schmaler Fußweg in Richtung Altstadt. Nach wenigen Minuten erreicht man die Pelzerstraße – eine der ältesten Straßen Emdens. Dort stehen die Pelzerhäuser: restaurierte historische Gebäude mit Fachwerkfassade. Gleich gegenüber erhebt sich die moderne Johannes a Lasco Bibliothek in den alten Mauern der einstigen Großen Kirche.
Pelzerhäuser & Johannes a Lasco Bibliothek – Altes Handwerk und geistiges Erbe
In der Pelzerstraße stoßen Besucher auf ein seltenes Ensemble: die Pelzerhäuser, benannt nach den Pelzhändlern, die hier einst wohnten und arbeiteten. Es handelt sich um die einzigen erhaltenen Renaissance-Bürgerhäuser in Emden. Ihre restaurierten Fassaden mit Ziergiebeln und Fachwerkelementen zeugen vom Reichtum einer kleinen, aber angesehenen Handwerkszunft im alten Emden. Heute sind die Gebäude öffentlich zugänglich und beherbergen wechselnde kulturelle Angebote.
Nur wenige Schritte entfernt steht ein Bauwerk von ganz anderem Format: die Johannes a Lasco Bibliothek, benannt nach dem reformierten Theologen aus dem 16. Jahrhundert. Sie befindet sich in der Ruine der Großen Kirche, die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde. Der Wiederaufbau kombinierte bewusst das erhaltene Mauerwerk mit moderner Architektur – ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie Vergangenheit und Gegenwart in Emden aufeinandertreffen.
Die Bibliothek ist eine der bedeutendsten theologischen Bibliotheken Deutschlands und zugleich ein Symbol für das reformatorische Erbe der Stadt. Neben dem wissenschaftlichen Betrieb finden hier auch Ausstellungen, Lesungen und Konzerte statt.
Weg zum Bunkermuseum: Von der Bibliothek führt der Weg zurück Richtung Stadtzentrum. Nach etwa zehn Minuten erreicht man einen unscheinbaren grauen Bau, der tief in die Erde reicht: das Bunkermuseum, ein Relikt aus dunkler Zeit.
Bunkermuseum & Kunsthalle – Erinnerung und Gegenwartskunst
Fast unscheinbar liegt das Bunkermuseum – ein massiver Betonbau, der im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker diente. Heute ist er ein Erinnerungsort. Im Inneren wird gezeigt, wie das Leben während der Bombenangriffe aussah: Enge, Dunkelheit, Angst. Die Ausstellung dokumentiert den Luftkrieg über Emden, den Alltag der Bevölkerung und den schwierigen Umgang mit der eigenen Vergangenheit.
Der Kontrast zur nächsten Station könnte kaum größer sein. Nur ein wenig weiter, am Rande ses Stadwalls, öffnet sich der Blick auf die Kunsthalle Emden. Gegründet wurde sie 1986 vom Journalisten Henri Nannen. Heute zählt sie zu den renommiertesten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst im Nordwesten. Die Sammlung reicht von Expressionisten wie Emil Nolde und Max Beckmann bis zu gesellschaftlich engagierten Ausstellungen der Gegenwart. Die Räume sind hell und offen – bewusst auf Dialog ausgelegt.
Weg zum Stadtwall: Von der Kunsthalle führt eine kleine Straße in Richtung Wallanlagen – der grüne Abschluss des Rundgangs.
Stadtwall & Windmühlen – Grüne Wege mit Geschichte
Der Emder Stadtwall ist das letzte Relikt einer einst wehrhaften Stadt. Im 17. Jahrhundert als sternförmige Festungsanlage errichtet, diente er dem Schutz vor Angriffen. Sein Bau war Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins und wurde mit Unterstützung niederländischer Ingenieure geplant. Heute ist der Wall ein grünes Band, das sich rund um die Innenstadt legt.
Besonders markant sind die beiden Windmühlen: die „De Vrouw Johanna“ und die „Rote Mühle“. Beide sind restauriert. Wer komplett über die Wallanlagen spaziert ( etwa 2,5 km ), hat Emden einmal umrundet – zu Fuß, durch Zeit und Raum. Der Stadtwall ist somit der passende Schlusspunkt: ein Ort der Ruhe, an dem Vergangenheit, Natur und Gegenwart ineinanderfließen.